Wer schubst hier wen zuerst vom Thron, fragt man sich unwillkürlich, aber das nur als freundliche Einleitung zum Nachfolgenden.
Der Titel trifft den Kern der Predigt des Herrn Roloff nur am Rand, das wird der geneigte Leser schnell selbst herausfinden.
Die Unterbrechung der letzten Monate war eine unfreiwillige. Jedoch scheint es jetzt wieder eine längere Fortsetzung zu geben. Wir hoffen einfach.
Predigt am drittletzten Sonntag des Kirchenjahres 2025
in Rothensee
Lk 6,27-38
Von der Feindesliebe
27Aber ich sage euch, die ihr zuhört: Liebet eure Feinde; tut denen wohl, die euch hassen;
28segnet die, so euch verfluchen und bittet für die, so euch beleidigen. 29Und wer dich schlägt auf einen Backen, dem biete den anderen auch dar; und wer dir den Mantel nimmt, dem wehre nicht auch den Rock. 30Wer dich bittet, dem gib; und wer dir das deine nimmt, da fordere es nicht wieder. 31Und wie ihr wollt, daß euch die Leute tun sollen, also tut ihnen gleich auch ihr. 32Und so ihr liebet, die euch lieben, was für Dank habt ihr davon? Denn die Sünder lieben auch ihre Liebhaber.
33Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, was für Dank habt ihr davon? Denn die Sünder tun das auch. 34Und wenn ihr leihet, von denen ihr hoffet zu nehmen, was für Dank habt ihr davon? Denn die Sünder leihen den Sündern auch, auf daß sie Gleiches wiedernehmen. 35Vielmehr liebet eure Feinde; tut wohl und leihet, daß ihr nichts dafür hoffet, so wird euer Lohn groß sein, und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein; denn er ist gütig über die Undankbaren und Bösen.
Von der Stellung zum Nächsten
36Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.
37Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammet nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebet, so wird euch vergeben. 38Gebt, so wird euch gegeben. Ein voll, gedrückt, gerüttelt und überfließend Maß wird man in euren Schoß geben; denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messet, wird man euch wieder messen.
Liebe Gemeinde,
„Selten so gelacht!“, so möchte man ausrufen, wenn man diesen Text liest, der so typisch für die Botschaft des lieben Jesus ist, der so naiv erscheint, der so voller Idealismus daherkommt.
Liebt eure Feinde, tut denen wohl, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen und bittet für die, so euch beleidigen. Wann jemals hätte sich das durchgesetzt?
Noch utopischer ist die immer wieder gehörte Forderung, die andere Wange hinzuhalten, wenn man auf die eine bereits geschlagen wurde und den Rock nicht zu versagen, wo der Mantel schon genommen wurde.
Als Lebensprinzip für diese Welt eignet sich das nicht! Für diese Welt ist es aber auch nicht!
Mit dem drittletzten Sonntag des Kirchenjahres beginnt eine Zeit, in der das Weltgericht, das nahende Himmelreich und das Ende aller Dinge verstärkt ins Bewusstsein gerückt werden. Die Liturgie unserer Gottesdienste ist ganz auf diese Fragen ausgerichtet. Darum hilft es uns vielleicht, in den Evangeliumstext des heutigen Tages zu schauen, wenn wir verstehen wollen, was der Predigttext meint.
Wenn vom Reich Gottes die Rede ist, dann fragen die Pharisäer nämlich gleich „Wann“? Christus aber antwortet: „Das Reich Gottes ist mitten unter euch!“
Das Reich Gottes verwandelt die Welt nicht durch sein Kommen. Das Reich Gottes verwandelt die Welt durch seine Gegenwart. Gott und sein Reich sind immer gegenwärtig. Wann war das auf Erden jemals sichtbarer als hier im Evangelium, wo Christus zu den Menschen von Angesicht zu Angesicht sprach. „Das Reich Gottes ist mitten unter euch!“ Jesus hätte auch sagen können, ich bin mitten unter euch.
Bei dem, was wir im Predigttext hören, geht es also nicht um eine Lebensordnung für Menschen und Völker. Eine Lebensordnung hat nur dann Sinn, wenn man sie durchsetzen kann. In unserem Predigttext geht es um die lebendige Gegenwart des Herrn.
Christus hat sich bis ans Kreuz hingegeben. In den Sakramenten empfangen wir ihn. Wir nehmen Anteil an ihm, sodass er mit uns in der Welt präsent ist. Gott ist gegenwärtig. Darum ist es von so zentraler Bedeutung, dass wir im Sakrament wirklich den Herrn empfangen und er an uns leiblich, das heißt, tatsächlich Anteil nimmt, ein Teil von uns wird. Hier ereignet sich dann nämlich die Verheißung: „Das Reich Gottes ist mitten unter euch!“
Das bedeutet dann aber auch nicht mehr ich liebe meine Feinde, sondern ich überlasse mich der Tatsache, dass der Herr seine Feinde geliebt hat und selbst seinen Henkern vergeben konnte. Er wirkt in mir seine Güte, weil die meine nicht ausreicht.
Für mich gibt Jesus Sirach die Regel vor. Dort heißt es im 12. Kapitel: 1Willst du Gutes tun, so sieh zu, wem du es tust; dann verdienst du Dank damit. 2Tu dem Frommen Gutes, so wird dir’s reichlich vergolten, wenn nicht von ihm, so doch gewiss vom Höchsten. 3Es gibt nichts Gutes für den, der beharrlich Böses tut und nicht gern Almosen gibt. 4Gib dem Frommen, doch des Frevlers nimm dich nicht an. 5Tu Gutes dem Demütigen, aber dem Gottlosen gib nichts. Verweigere ihm dein Brot und gib ihm nichts, damit er dadurch nicht stärker wird als du: Denn du wirst doppelt so viel Schlechtes empfangen, wie du ihm Gutes getan hast. 6Denn auch der Höchste ist den Sündern feind und wird die Gottlosen bestrafen. [Doch er bewahrt sie bis zum Tag ihrer Strafe.] 7Gib dem Guten, doch des Frevlers nimm dich nicht an.
Erst durch das Wirken Jesu, unseres Erlösers, wird eine ganz neue Dimension aufgetan. Christus hat durch sein unschuldiges Leiden das Wunder vollbracht, dass alle, durch die er litt, Mitwirkende an seinem Heilswerk wurden. Die Menschen, die Jesus quälten, verspotteten, schlugen, kreuzigten und am Ende töteten, die drangen mit ihren Absichten nicht mehr hindurch, sie konnten ihr Ziel nicht mehr erreichen, sondern wurden Vollstrecker von Gottes Willen, das Böse zu überwinden. Sie sind dadurch nicht gerechtfertigt, sondern endgültig und vollständig besiegt. Aber gerade darum trifft sie nun auch Gottes Erbarmen.
Das nämlich ist wiederum der am meisten verstörende Satz aus unserem Predigttext: „35Vielmehr liebet eure Feinde; tut wohl und leihet, daß ihr nichts dafür hoffet, so wird euer Lohn groß sein, und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein; denn er ist gütig über die Undankbaren und Bösen.“
Gott ist gütig über die Undankbaren und Bösen! Wir erwerben uns durch unser Tun keinen Vorzug, wir sind nicht besser als die Sünder, denn auch wir sind und bleiben Sünder und seines Erbarmens bedürftig. Die Kirche ist eben keine Umerziehungsanstalt, die bessere Menschen hervorbringt, die dann hochmütig auf die Ungläubigen blicken, wie die Pharisäer auf die Zöllner, sondern sie ist der Ort von Jesu Gegenwart und von seinem Wirken.
Wir wissen den Herrn in uns und dürfen uns gerade in unserer Sündhaftigkeit seinem Wirken überlassen. Er wirkt alles in uns. Durch ihn lieben wir unsere Feinde, tun denen wohl, die uns hassen; segnen die, so uns verfluchen und bitten für die, so uns beleidigen.
Der getaufte und gläubige Christ kann Christus durch sich in der Welt wirken lassen und das schon gekommene Reich Gottes sichtbar machen. Das ist das größte Wunder, dass aus der Gegenwart der Kirche heraus wachsen kann, weil sie seine Gegenwart ist und außerhalb der Kirche ist darum auch kein Heil, weil es ohne Christus kein Heil gibt.
Ihn wollen wir darum loben und ehren und anbeten. Amen
Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus unserem Herrn.
Amen
Thomas Roloff



















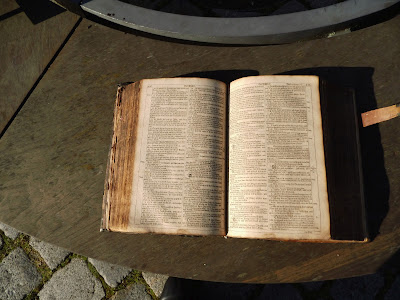



_Battaglia_di_Lepanto_-_Andrea_Vicentino_-_Correr_Museum.jpg)

_-_Sacristy_-_triptych_by_Giovanni_Bellini_-_Saint_Benedict_of_Nursia_and_Saint_Mark.jpg)

.jpg)


.jpg)















